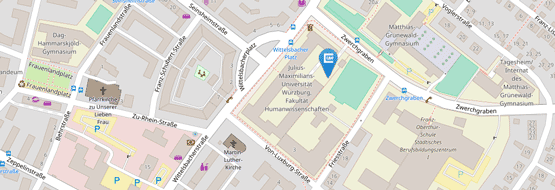Veranstaltungen im SoSe 2025
Workshop: Rassismus erkennen und darauf reagieren
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Interkulturelle Kompetenz in der Sonderpädagogik“ (IKiS) fand in Kooperation mit der Würzburger Woche gegen Rassismus am 22.05.2025 ein Workshop statt.
Rassismus kann uns in allen Kontexten begegnen – sowohl im öffentlichen als auch im privaten, vertrauten Raum. Doch was bedeutet es eigentlich, Rassismus zu erkennen – und was braucht es, um darauf zu reagieren? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Teilnehmenden des Workshops „Rassismus erkennen und darauf reagieren“, der am 22. Mai 2025 in Kooperation mit der Würzburger Woche gegen Rassismus stattfand. Geleitet wurde der Workshop von Maurice Soulié, Bildungsreferent mit dem Schwerpunkt Antirassismus und Empowerment.
Zu Beginn des Workshops ordneten die Teilnehmenden ein, wie vertraut sie bereits mit den Themen Rassismus, Weißsein und Privilegien sind. Maurice Soulié führte anschließend in das Konzept des antizipierten Rassismus ein – die Erfahrung, aufgrund gesellschaftlicher Bedingungen immer wieder mit Rassismus rechnen zu müssen – und verdeutlichte dessen Auswirkungen.
Um sich dem Thema zu nähern, wie die Teilnehmenden auf Rassismus reagieren können, wurden typische Abwehrmechanismen bei einer Konfrontation mit Rassismus betrachtet. In interaktiven Formaten wie einem „unromantischen Speeddating“ beschäftigten sich die Teilnehmenden in Kleingruppen mit alltäglichen, aber oft problematischen Aussagen wie „Woher kommst du wirklich?“ oder „Man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen“.
Zum Abschluss wurden konkrete Szenarien aus dem Alltag durchgespielt – etwa rassistische Aussagen von Busfahrer:innen, rassistische Kostüme auf einer Party oder ein „Witz“ auf einem Spieleabend. Gemeinsam wurden Handlungsoptionen entwickelt, die aufzeigen, wie auch in schwierigen Momenten Haltung gezeigt und ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt werden kann.
Die Stimmung während des gesamten Workshops war offen, wertschätzend und von gegenseitigem Lernen geprägt. Die Teilnehmenden konnten zahlreiche Impulse mitnehmen – sowohl für den persönlichen Umgang mit Rassismus als auch für das eigene Umfeld.
Maurice Soulié hat durch eine Kombination aus fachlichem Input, eigener Erfahrung und interaktiven Übungen den Workshopteilnehmenden ermöglicht, eigenes Handeln und Denken zu hinterfragen und Wege zu erarbeiten, um auf Rassismus zu reagieren.
Hintergrund des Referierenden:
Maurice Soulié (er/ihm) ist Bildungsreferent mit Fokus auf Antirassismus und Empowerment. In seiner Arbeit entwickelt und leitet er Workshops, Vorträge sowie Trainings zur Sensibilisierung für diskriminierungskritisches Denken und Handeln. Dabei richtet er sich an verschiedene Zielgruppen – Studierende, Lehrkräfte, Dozent*innen, Pädagog*innen bis hin zu Teams in Organisationen und Unternehmen. Er begleitet zudem Prozesse der rassismuskritischen Reflexion und Veränderung in pädagogischen wie beruflichen Kontexten.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Maurice Soulié für den sehr lehrreichen und informativen Workshop, bei der Würzburger Woche gegen Rassismus für die Kooperation, bei den Studierenden für ihre Teilnahme, Mitarbeit und ihr Interesse an der Themenstellung, beim GSiK-Team samt studentischen Hilfskräften für die finanzielle und organisatorische Hilfe sowie bei unserem Lehrstuhlinhaber Herrn Univ.-Prof. Dr. Roland Stein für die Unterstützung.
Ein Beitrag von Kim Gärtner, Hilfskraft am Lehrstuhl Pädagogik bei Verhaltensstörungen.
Bericht: „Warum wir uns über moralische Fragen so heftig streiten“
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Interkulturelle Kompetenz in der Sonderpädagogik (IKiS) fand am 02.06.2025 ein Vortrag mit Prof. Dr. Karl Mertens zum Thema Moral und gesellschaftlicher Diskurs statt.
In seinem Vortrag widmete sich Prof. Dr. Karl Mertens der Frage, weshalb moralische Diskussionen im Alltag oft besonders emotional beladen sind und häufig kontrovers geführt werden. Mithilfe eines ausgeteilten Handouts führte er die anwesenden Studierenden sehr zugänglich und nachdenklich stimmend in ein philosophisches und komplexes Thema ein. Dabei griff Prof. Mertens viele Beispiele aus dem Alltag, aus den Medien und der Politik auf – etwa zu Genderdebatten, Nachhaltigkeit oder Krieg – und zeigte damit, wie schnell moralische Bewertung den Verdacht gesellschaftlicher Spaltungen aufwerfen kann.
Zentral sind dabei drei Merkmale moralischer Einstellungen:
Unparteilichkeit (universale Geltung der Handlung), Verantwortlichkeit (die Absicht ist entscheidend) und autonomes moralisches Handeln aus einer inneren Überzeugung heraus. Hier verdeutlichte Prof. Mertens entschieden den Unterschied zu sozialen Normen, die häufig nur befolgt werden, um Sanktionen zu vermeiden. Moralisches Handeln geschieht hingegen aus einer inneren Überzeugung und Verinnerlichung heraus und berührt den Kern der eigenen Persönlichkeit.
Besonders interessant für die Teilnehmenden war der Gedankengang, dass Menschen über verschiedene moralische Quellen verfügen (bspw. Gerechtigkeit, Nutzen, persönliche Verpflichtungen oder auch gegebene Rahmenbedingungen), die oft nicht miteinander vereinbar sind. Dies lässt sich vor allem anhand moralischer Dilemmata zeigen: unsere Intentionen gehen oftmals in beide Richtungen, so dass unsere moralische Urteilsfähigkeit oft an Grenzen stößt, aber gleichzeitig nicht verzichtbar bleibt.
Im weiteren Verlauf des Vortrags wurde diskutiert, wie mit der Komplexität moralischer Fragen im Alltag umgegangen werden kann. Und so stellte Prof. Dr. Mertens in den Raum, ob moralische Fragen und Konflikte nicht auch institutionell – etwa durch rechtliche Bestimmungen – entschärft werden können, um persönliche Konflikte zu vermeiden.
Der Vortrag von Prof. Dr. Mertens war anschaulich, alltagsnah und hat aufgrund vieler Beispiele aus dem Alltag zum Nachdenken angeregt.
Hintergrund des Referenten:
Prof. Dr. Karl Mertens hat Philosophie, deutsche Philologie und Geschichte in Köln, Freiburg und Zürich studiert. Nach seinen wissenschaftlichen Stationen in Köln und Kiel ist er seit 2004 am Institut für Philosophie der Universität Würzburg tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind Handlungstheorie, Sozialphilosophie, Erkenntnistheorie, Ethik, Philosophie des Geistes und Phänomenologie.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Prof. Dr. Karl Mertens für den sehr lehrreichen und informativen Vortrag, bei den Studierenden für ihre Teilnahme, Mitarbeit und ihr Interesse an der Themenstellung, beim GSiK-Team samt studentischen Hilfskräften für die finanzielle und organisatorische Hilfe sowie bei unserem Lehrstuhlinhaber Herrn Univ.-Prof. Dr. Roland Stein für die Unterstützung.
Ein Bericht von Kim Gärtner und Mina Gölzer, wissenschaftliche Hilfskräfte am Lehrstuhl Pädagogik bei Verhaltensstörungen.
11.06.2025, 16-18 Uhr
Referentin: Marjorie Berns
Inhalt: Obwohl offener Rassismus im Fußball zurückgegangen ist, zeigen sich rassistische Mechanismen in subtileren Formen – zum Beispiel in der Verteilung von Spielpositionen. Der Vortrag beleuchtet das Phänomen des „racist stacking“, also die systematische Zuweisung von Spielerpositionen entlang rassifizierter Zuschreibungen. Anhand aktueller Forschungsergebnisse – u.a. aus experimentellen Studien – wird gezeigt, wie Schwarze und weiße Spieler unterschiedlich bewertet werden, insbesondere wenn objektive Leistungsdaten fehlen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass in ambivalenten Entscheidungssituationen stereotype Vorstellungen („controlling images“) die Einschätzung von Spielereignung beeinflussen können.
Der Vortrag diskutiert die Implikationen dieser Mechanismen für strukturellen Rassismus im Sport und lädt zur kritischen Auseinandersetzung mit impliziten Bewertungsmustern im Fußball ein.
Bericht „Ableismus entlernen – ein Impuls aus der Community“
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Interkulturelle Kompetenz in der Sonderpädagogik“ (IKiS) fand am 25.06.2025 ein Workshop mit Jan Kampmann und Johanna Polley zum Thema „Ableismus entlernen – ein Impuls aus der Community“ statt. Als Personen mit einer sichtbaren und einer nicht-sichtbaren Behinderung berichteten sie von eigenen Diskriminierungserfahrungen, die ihnen im Alltag und in ihrem Beruf als Schauspielende begegnen, thematisierten exkludierende Praktiken und Phänomene.
Zu Beginn gab es eine Vorstellungsrunde der Teilnehmenden, die aus verschiedenen Studiengängen und Fachrichtungen kamen und darum ein sehr heterogenes Vorwissen hatten. Die Referierenden nahmen die unterschiedlichen Interessensschwerpunkte der Teilnehmenden auf, um im Workshop darauf eingehen zu können.
Im Anschluss erfolgte ein kurzer theoretischer Input zum Thema Ableismus. Johanna Polley ging hierbei auch auf das Konzept der Intersektionalität ein und wies darauf hin, dass es einige Parallelen zwischen verschiedenen aktivistischen Bewegungen, wie beispielsweise der queeren Community oder der BIPOC-Community, gibt, und die Verbindungen und die Solidarität zwischen diesen Communities zunehmen.
Es folgten einige Erfahrungsberichte der Referierenden über alltägliche Diskriminierungserfahrungen, die sie erlebt haben. Hierzu zählen auch Handlungen anderer Personen, die eigentlich „gut gemeint“ waren, aber dennoch eine aussondernde Wirkung erzielten. Die Referierenden berichteten von Beispielen aus der Schule, wie dem Ausschluss von bestimmten Teilen des Sportunterrichts, der Schauspielschule oder ihrer Freizeit. Hierbei übten sie vor allem Kritik an der Reduktion auf ihre Behinderung sowie an gut gemeinten Handlungen, die sie dennoch als anders markieren. Die Referierenden führten verschiedene Möglichkeiten auf, wie sich Personen verhalten können, ohne Menschen mit Behinderungen diskriminierend zu begegnen: Beispielsweise zu fragen, ob und was sich die Person zutraut oder die Möglichkeit zu erhalten, die eigenen Grenzen auszutesten und möglicherweise auch scheitern zu dürfen, anstatt präventiv „geschont“ zu werden.
Die Referierenden berichten von einem Anpassungsdruck an die Dominanzgesellschaft, den Menschen mit Behinderung häufig verspürten, um nicht aufzufallen. Diesen Anpassungsdruck erleben die Referierenden insbesondere in ihrem Beruf als Schauspielende:r, da sie häufig als Repräsentierende einer Gruppe wahrgenommen werden und sich Gedanken machen müssen, ob sie für den Abbau von Barrieren eintreten und dadurch möglicherweise riskieren, als „schwierig“ angesehen zu werden, was auch auf andere Schauspielende mit Behinderung übertragen werden könnte.
Anschließend lernten die Teilnehmenden anhand eines Gedichts, das Jan Kampmann im Rahmen seiner Schauspieltätigkeit einsprechen sollte, das Phänomen Inspiration Porn kennen. Dieses Gedicht handelte vom Gefühl, mit einer Behinderung zu leben, wurde jedoch von einer Person ohne Behinderung geschrieben und sollte womöglich eine inspirierende Wirkung haben. Durch dieses Gedicht wurde der*die Sprecher:in jedoch auf die Behinderung reduziert und das Gefühl, mit einer Behinderung zu leben, wurde durch eine andere Person eingeschätzt, die dieses Gefühl nicht erlebt hat. Das Gedicht vermittelt den Eindruck, dass man mit Willen alles schaffen kann, wenn auch Menschen mit Behinderung das können, und ist damit repräsentativ für den Inspiration Porn.
Abschließend gab es Raum für Fragen und einen offenen Austausch. Beide Referierende schafften eine sehr offene und wertschätzende Workshop-Atmosphäre, die von einer regen Teilnahme und einer hohen Aufmerksamkeit geprägt war. Hierfür und für die interessanten Einblicke möchten wir uns herzlich bedanken!
Hintergrund der Referierenden:
Jan Kampmann ist Journalist und Schauspieler. Er arbeitet als Reporter und Redakteur für die ARD, mit einem besonderen Fokus auf Diversity-Themen. Außerdem ist er als Sensivity-Reader tätig und setzt sich für inklusivere Strukturen in der Schauspielbranche ein.
Johanna Polley ist als Schauspielerin unter anderem im Tatort zu sehen. Sie engagiert sich bei ProQuoteFilm, einem Verein der sich für Gendergerechtigkeit, Diversität und Inklusion in der Film- und Fernsehbranche einsetzt.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Johanna Polley und Jan Kampmann für den sehr lehrreichen und anregenden Workshop, bei den Studierenden für ihre Teilnahme, Mitarbeit und ihr Interesse an der Themenstellung, beim GSiK-Team samt studentischen Hilfskräften für die finanzielle und organisatorische Hilfe sowie bei unserem Lehrstuhlinhaber Herrn Univ.-Prof. Dr. Roland Stein für die Unterstützung.
Ein Beitrag von Mina Gölzer, Hilfskraft am Lehrstuhl Pädagogik bei Verhaltensstörungen.